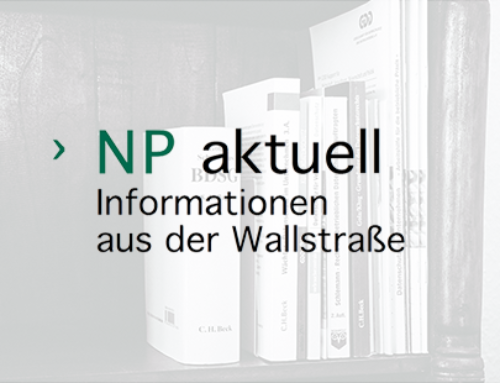Das Oberlandesgericht München (Urt. v. 07.04.2025, Az. 33 U 241/22) hat entschieden, dass ein Testamentsvollstrecker seine Vergütung vollständig zurückzahlen muss, wenn er seine Amtspflichten schwerwiegend verletzt.
Für Erblasserinnen und Erblasser bietet die Anordnung einer Testamentsvollstreckung die Möglichkeit sicherzustellen, dass ihre letzten Wünsche auch tatsächlich umgesetzt werden.
Dabei ist neben der Wahl einer vertrauenswürdigen Person auch eine klare Regelung zur Vergütung dringend zu empfehlen.
Nach dem Erbfall hat der Testamentsvollstrecker die Aufgabe, den Willen der verstorbenen Person zu erfüllen. Es bestehen dabei zahlreiche organisatorische und rechtliche Pflichten.
Im entschiedenen Fall hatte der Testamentsvollstrecker mehrfach hohe Beträge aus dem Nachlass entnommen, um eigene Prozesskosten zu bezahlen. Das Gericht sah darin einen gravierenden Pflichtverstoß: Die Vergütung war verwirkt und musste in voller Höhe zurückgezahlt werden.
Wichtig: Eine Vergütung darf, wenn sich aus dem Testament nichts anderes ergibt, erst nach Beendigung der Testamentsvollstreckung und Vorlage einer Schlussabrechnung ausgezahlt werden. Eine vorzeitige Entnahme ist nicht zulässig und kann sogar als Untreue (§ 266 StGB) strafbar sein – unabhängig davon, ob das Geld später zurückgezahlt wird.
Entnimmt ein Testamentsvollstrecker Nachlassgelder zur Finanzierung eigener Prozesse, verliert er nicht nur seinen Vergütungsanspruch. Zusätzlich droht eine persönliche Schadensersatzpflicht gegenüber den Erbinnen und Erben.
Die Entscheidung macht deutlich, dass neben einer sorgfältigen Auswahl des Testamentsvollstreckers auch eine klare Vergütungsregelung und eine offene Kommunikation des Testamentsvollstreckers mit den Erbinnen und Erben entscheidend sind, um Konflikte und rechtliche Risiken zu vermeiden. Für Erbinnen bedeutet die Entscheidung gleichzeitig mehr Sicherheit – sie sind nicht schutzlos, wenn ein Testamentsvollstrecker seine Pflichten verletzt.